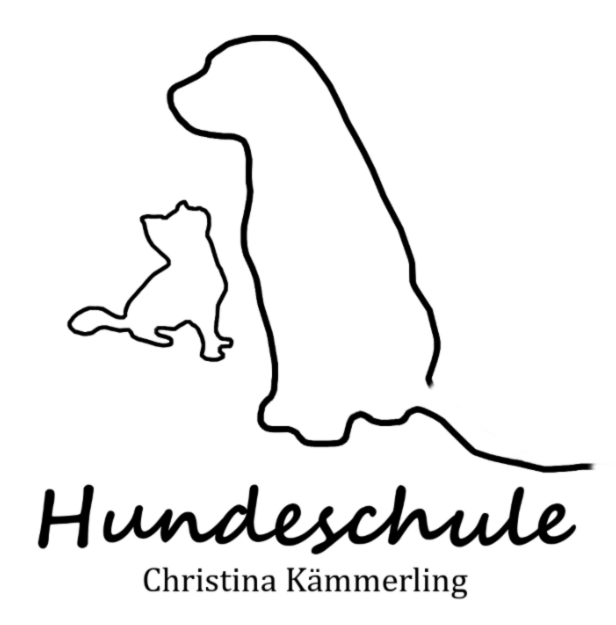Hundetraining wird in der Szene leidenschaftlich diskutiert.
Die einen schwören auf Beziehungsarbeit, die nächsten auf klare Unterordnung, wieder andere arbeiten ausschließlich positiv.
Doch was steckt wirklich hinter diesen Ansätzen – und warum gibt es so viele unterschiedliche Meinungen?
Bevor wir uns die einzelnen Strömungen anschauen, lohnt sich ein kurzer Abstecher in die Welt der Lerntheorie. Denn wer versteht, wie Hunde lernen, erkennt schnell, dass viele Trainingsansätze gar nicht so gegensätzlich sind, wie sie auf den ersten Blick wirken.

Inhalt
Klassische Konditionierung – Pavlovs Entdeckung
IIvan Pawlow – den Namen kennst du vielleicht noch aus der Schule – untersuchte ursprünglich den Speichelfluss bei Hunden.
Dabei machte er eine berühmte Entdeckung: Wenn er vor der Futtergabe eine Glocke läutete, begannen die Hunde schon beim Klang der Glocke zu speicheln.
Sie hatten gelernt: Glocke = Futter kommt.
Dieses Prinzip nennt man klassische Konditionierung oder einfach gesagt ein Reiz-Reaktions-Muster.
Ein neutraler Reiz (die Glocke) wird mit einem bedeutungsvollen Reiz (dem Futter) verknüpft, bis er dieselbe körperliche oder emotionale Reaktion auslöst.
Operante Konditionierung – Skinner und das aktive Lernen
Einige Jahrzehnte später erforschte B. F. Skinner, wie Tiere durch ihr Verhalten selbst Einfluss auf Konsequenzen nehmen – die sogenannte operante Konditionierung.
Er beschrieb vier Möglichkeiten, Verhalten zu beeinflussen:
- Positive Verstärkung: Etwas Angenehmes wird hinzugefügt → Verhalten tritt häufiger auf.
Beispiel: Dein Hund setzt sich, du sagst „Yes!“ und gibst ein Leckerli. - Negative Verstärkung: Etwas Unangenehmes hört auf → Verhalten tritt häufiger auf.
Beispiel: Du hältst sanft Druck auf die Leine, der nachlässt, sobald dein Hund stehen bleibt. - Positive Strafe: Etwas Unangenehmes wird hinzugefügt → Verhalten tritt seltener auf.
- Negative Strafe: Etwas Angenehmes wird entzogen → Verhalten tritt seltener auf.
Beispiel: Dein Hund springt dich an, du drehst dich weg und verweigerst Aufmerksamkeit.
Wichtig dabei: „Positiv“ und „negativ“ bedeuten nicht gut oder schlecht, sondern lediglich etwas wird hinzugefügt bzw. etwas wird weggenommen.
In der Praxis konditionieren wir immer – ob bewusst oder unbewusst.
Jedes Lob, jedes Signal, jedes Wegsehen hat eine Wirkung.
Rein positives Training

In dieser Trainingsphilosophie geht es darum, Situationen so zu gestalten, dass der Hund fast ausschließlich erwünschtes Verhalten zeigen kann – und dieses Verhalten dann belohnt wird.
Fehler sollen möglichst gar nicht erst entstehen, Frust wird weitgehend vermieden.
Gearbeitet wird in kleinen, klaren Schritten. Ziel ist ein Hund, der mit Freude und Vertrauen lernt.
Das funktioniert hervorragend, wenn der Mensch seine Umgebung clever managt. Allerdings ist es in der Realität kaum möglich, rein positiv zu trainieren – irgendwann kommt jeder Hund in Situationen, in denen Grenzen oder Frustration dazugehören. Und das ist völlig okay, solange es fair bleibt.
Raumverwaltung
Der Begriff „Raumverwaltung“ stammt nicht aus der Wissenschaft, sondern beschreibt eine körpersprachlich orientierte Trainingsform.
Hier geht es darum, dass der Mensch den zur Verfügung stehenden Raum lenkt – wer bewegt sich wo, wer weicht wem aus.
Hunde denken häufig in räumlichen Strukturen: drinnen oder draußen, vor oder hinter dir, auf dem Weg oder daneben.
Über diese räumliche Klarheit lässt sich Verhalten gut steuern.
Ein Beispiel: Der Hund soll auf dem Spaziergang auf dem Weg bleiben.
Wenn er diesen verlassen will, „fragt“ er, indem er Blickkontakt sucht oder wartet. So entstehen Regeln, die der Hund versteht, weil sie über Körpersprache vermittelt werden.
Beziehungsarbeit
Hier steht die emotionale Verbindung im Vordergrund.
Hund und Mensch sollen sich gegenseitig verstehen lernen – auf Augenhöhe. Vertrauen, Kommunikation und gemeinsame Erlebnisse sind wichtiger als perfekte Kommandos.
Beziehungsarbeit kann Elemente aus allen Trainingsrichtungen enthalten, solange sie die Bindung stärkt und das Zusammenleben harmonischer macht.
Unterordnung
Dieser Ansatz basiert auf der Idee, der Mensch müsse die „Führung übernehmen“ und der Hund habe sich unterzuordnen.
Abweichungen werden häufig mit Druck oder Strafe korrigiert.
Diese Denkweise beruht auf der veralteten Dominanztheorie, nach der Hunde innerhalb eines Rudels ständig um Rangpositionen kämpfen.
Heute weiß man: Das soziale Gefüge von Hunden (und auch Wölfen) ist viel flexibler. Hunde orientieren sich an Kooperation, nicht an Unterwerfung.
Deshalb führt „harte Hand“ oft eher zu Misstrauen als zu Respekt.
________________________________________________________________________________________________________________
Wenn du mich fragst, wo ich mich einordne – dann ganz klar: nirgendwo.
Ich trainiere nach der Premisse: Lerntheorie und Logik.
Die Lerntheorie liefert mir das Handwerkszeug, um Verhalten zu verstehen und gezielt zu verändern.
Ich arbeite in der Regel mit positiver Verstärkung, weil sie Motivation und Freude am Lernen schafft. Aber: Nur „rein positiv“ ist faktisch nicht möglich.
Wenn ich ein Leckerli verweigere, weil der Hund ein Signal nicht befolgt, ist das bereits eine Form der (milden) Strafe – völlig normal und im Lernprozess unvermeidbar.
Mir persönlich ist wichtig, dass meine Hunde, wenn ich mich unterhalte oder etwas erkläre, neben mir sitzen und in den Ruhemodus schalten.
Ich brauche das im Alltag, weil ich regelmäßig im Training bin und mich konzentrieren möchte.
Für viele meiner Kundinnen und Kunden ist das aber gar nicht relevant. Sie brauchen einen verlässlichen Rückruf oder ein „Bleib“ auf Distanz, wenn Radfahrer oder Jogger vorbeikommen.
Das ist Logik im Hundetraining: Ich bringe das bei, was im Alltag wirklich hilft. Kein Schema F, sondern individuelles, situationsgerechtes Training.
________________________________________________________________________________________________________________
Fazit
Hundetraining ist keine Glaubensfrage.
Es geht nicht um „die eine richtige Methode“, sondern darum, zu verstehen, wie Lernen funktioniert – und das logisch, fair und an den Alltag angepasst umzusetzen.
Egal, ob du gerade mit deinem Welpen startest, mitten in der Pubertät steckst oder an Feinheiten arbeitest:
Wenn du Lust hast, das Training mit Lerntheorie, Logik und Herz anzugehen, dann lass uns sprechen.
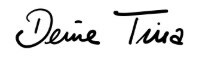

Hundetrainerin im Raum Köln